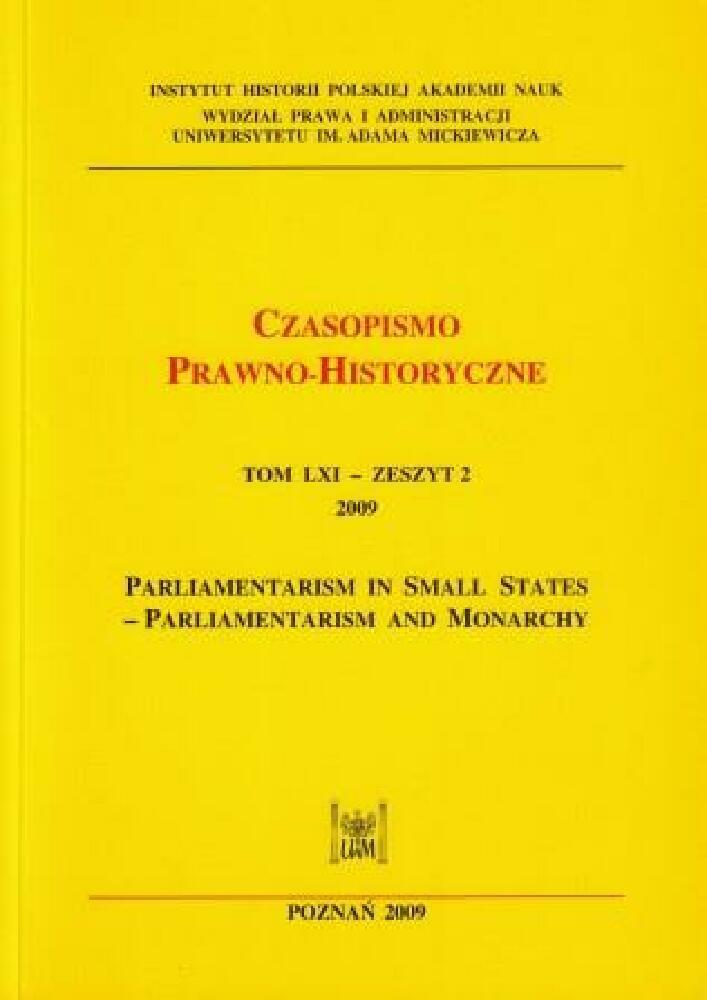Abstrakt
„Rezeption ist ein Faktum!” Mit diesen Worten argumentierte der Leiter des Justizressorts Walter Kieber 1971 im liechtensteinischen Landtag, der damals am Beginn einer umfassenden Justizrechtsreform stand. Er verwies damit auf eine zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 150-jährige Rezeptionsgeschichte, die als Beweis dafür dienen sollte, dass an der Rezeption ausländischen Rechts auch in Zukunft kein Weg vorbeiführen werde.
Die Rezeptionsgeschichte begann mit der Rezeption3 des österreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs von 1811 sowie weiterer österreichischer Gesetze mittels Fürstlicher Verordnung vom 18. Februar 1812. Mit diesem Schritt vertiefte das seit 1806 souveräne Fürstentum Liechtenstein seine Beziehungen zu seinem östlichen Nachbarland, die zu einem Gutteil auf der engen Verbindung seines Fürstenhauses mit dem österreichischen Kaiserhaus beruhten. Auf die 1819 veranlasste „automatische” Übernahme österreichischen Rechts – d.h. dass alle zu den rezipierten Gesetzen erlassenen Erläuterungen und Nachtragsverordnungen ohne weiteren Rechtsakt auch in Liechtenstein in Kraft traten – folgte ab 1843 die „autonome” Rezeption österreichischen Rechts. Das bedeutete, dass zwar weiterhin rezipiert wurde, aber nicht mehr wie bisher pauschal und unverändert, sondern mit Modifikationen und Anpassungen und zudem oft erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung. Zu der mit der Rezeption der wichtigsten Justizgesetze geschaffenen engen Anbindung Liechtensteins an Österreich kamen noch weitere verbindende Elemente hinzu. Mehr als ein Jahrhundert lang – von 1818 bis 1922 – fungierte das für Tirol und Vorarlberg zuständige Appellationsgericht und spätere Oberlandesgericht in Innsbruck als Höchstgericht in liechtensteinischen Zivilund Strafsachen und sorgte solchermaßen für die Aufrechterhaltung der Rechtsübereinstimmung. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang – von 1852 bis 1919 – schuf die zwischen den beiden Nachbarländern bestehende Zollunion ein enges wirtschaftliches Naheverhältnis, das durch eine gemeinsame Währung und ein einheitliches Postwesen ergänzt wurde. Diese engen rechtlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den beiden Nachbarstaaten ließen Liechtenstein nach außen nicht wie einen souveränen Staat, sondern eher wie eine „österreichische Provinz” erscheinen.
Finansowanie
Digitalizacja i Otwarty Dostęp dofinansowane przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach umowy nr BIBL/SP/0002/2023/1
Licencja
Copyright© 2009 Wydział Prawa i Administracji UAM w PoznaniuOPEN ACCESS